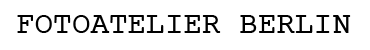26 Okt. In der Süddeutschen Zeitung



Hannover – Zu den aufregendsten Dingen in Niedersachsen gehören die Kühlregale in den Supermärkten. In niedersächsischen Supermarkt-Kühlregalen gibt es Bockwurst aus der eigenen Herstellung von Volkswagen. Unmittelbar daneben steht das passende VW-Gewürzketchup. 2,79 Euro die Flasche. Man bekommt diese beiden Dinge, die Zutaten für eine echte Volkswagen-Currywurst, nur hier. In Niedersachsen. In VW-Land.
Niedersachsen und VW. Ein Land und seine wichtigste Firma. Über Jahrzehnte kannte man hier keine Trennung. Wo der Konzern aufhörte und wo das Land begann, es wusste niemand – und es war auch nicht von Bedeutung. Die Interessen schienen immer deckungsgleich zu sein, und wer hier fragte, ob es nicht auch Trennendes geben könnte, beim Umweltschutz zum Beispiel, oder vielleicht bei Arbeitnehmerrechten, bekam nicht mal eine Antwort, sondern bloß verständnislose Blicke.
Volkswagen war überall in Niedersachsen, jedes Sportfest, jede Ausstellung, jedes neue Kulturzentrum, immer war Volkswagen mit im Spiel, und das Land dankte es mit fast rührender, kritikloser Identifikation. „Wenn Volkswagen hustet, hat Niedersachsen die Grippe“, sagten sie hier gern. Und so war dieses Land geprägt von dem Bemühen, eine Wellness-Oase zu sein für diesen Konzern. Für seinen Konzern.
Das Bundesland, der Weltkonzern – die Interessen schienen immer deckungsgleich
Dann kam die Abgasaffäre. Sie erschütterte Volkswagen in seinen Grundfesten, und sie veränderte die deutsche Autoindustrie für immer. Niedersachsen aber war hin- und hergerissen zwischen seiner jahrzehntelang geübten, bedingungslosen Loyalität auf der einen Seite und einer Mischung aus Angst und Fassungslosigkeit auf der anderen. Was würde nun werden?
An diesem Sonntag wird in Niedersachsen gewählt, gut zwei Jahre, nachdem die Abgasmanipulationen aufgeflogen sind. Und heute ist klar: Die Abgasaffäre hat die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Parameter in diesem Bundesland grundlegend verschoben.
Da ist zunächst die Sache mit dem Geld. Wenn man etwas über die Sache mit dem Geld erfahren will, kann man zum Beispiel hoch an die Nordsee fahren, bis nach Emden. Man verlässt dann in Emden-West die Autobahn, die dort endet, und schaut auf die Straße. HAFEN steht da in weißer Schrift links sehr groß auf dem Asphalt und rechts in ebenso dicken Buchstaben: VW. Genaugenommen führen beide Richtungen zu Volkswagen, denn außer VW-Werken gibt es in dieser ostfriesischen Stadt auch Überseeterminals, an denen Millionen Volkswagen von Zügen und enormen Parkplätzen auf Schiffe gefahren werden. Diese schwimmenden Riesengaragen tragen sie dann über die Meere. Mehr als 9000 Menschen arbeiten bei VW in Emden, viele weitere Tausend im Hafen.
Nimmt man die Zulieferer dazu, so hängen die meisten Familien hier und in der Umgebung irgendwie von Volkswagen ab. „Dat Käferhuus“ heißt eine Kita gegenüber von VW in Emden. Seit dem Niedergang von Fischerei und Werften ist VW der bei Weitem bedeutendste Arbeitgeber dieser etwas abgelegenen Gegend. Entsprechend schwierig ist es, das heikle Thema an solchen Orten halbwegs unabhängig zu erörtern. Und entsprechend haben die Dieselaffäre und ihre Folgen Emden erfasst.
„Große finanzielle Herausforderungen“ würden auf die Stadt zukommen, hieß es Ende 2016 aus dem Rathaus. Es gab zwischendurch Kurzarbeit bei VW Emden, die Produktion des Passat CC wurde eingestellt. Mittlerweile entsteht in Emden der Nachfolger Arteon, von 2019 an soll ein weiteres Modell dazukommen. „Dies ist und bleibt für Emden existenziell“, sprach Emdens Bürgermeister Bernd Bornemann von der SPD. Doch Gewerbesteuern von Volkswagen habe Emden schon seit 2015 nicht mehr eingenommen, meldete die Stadtverwaltung.
„Erhebliche Einsparungen im Haushalt aufgrund der VW-Krise“, kündigte Schatzmeister Horst Jahnke Ende 2016 an. Für 2017 gehen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wohl auf 43 Millionen Euro zurück – 2014 waren es noch 71,1 Millionen Euro gewesen. Das ist trotz Rücklagen ein üppiger Verlust für eine Kommune mit 51 000 Einwohnern. Von 2018 an werden 8,1 bis 10,4 Millionen Euro im Jahr fehlen. Was macht man da?
Man werde so streichen, dass die Bürger möglichst wenig mitbekommen würden, kündigte Stadtoberhaupt Bornemann an. Nachsatz: „Wegen des Steuerausfalls durch Volkswagen müssen wir aber Einschnitte vornehmen, die wehtun. Ohne geht es nicht.“
Es gab, buchstäblich, keine Ecke, in der Emden nicht nach Einsparmöglichkeiten suchte. Die Neuausschreibung der Rattenbekämpfung könne 80 000 Euro einsparen, lautete eine der Ideen. Von der Erhöhung der Hundesteuer war die Rede. Die „Müllgebühren von Inkontinenzkranken“ wurden genannt. Es wurde erwogen, die Straßenbeleuchtung in Gewerbegebieten zeitweise abzuschalten.
Nicht alles davon geschah. Bisher wurden unter anderem die Grundsteuer B, die Vergnügungssteuer und Gebühren erhöht, Zuschüsse gesenkt, Öffnungszeiten der Museen verkürzt. Von „Verringerung Personalaufwand“ und „Prozessveränderungen im Sozialbereich“ berichtet die Stadt.
Die Gesamtsituation hatte auch Folgen in der Kommunalpolitik. In einem kleinen Büro in der tristen Fußgängerzone von Emden liegt die Geschäftsstelle der neuen Partei „Gemeinsam für Emden“, kurz GfE. Bei der Kommunalwahl 2016 gewann sie aus dem Stand 20,2 Prozent der Stimmen. Die SPD verlor ungefähr genauso viel und mithin ihre absolute Mehrheit, diese GfE ist seither noch vor der CDU zweite Kraft im Rat. Eine lokalpolitische Erschütterung mitten im VW-Debakel.
Die Partei profitiert von der Ungewissheit und dem Ärger der Bevölkerung, aber auch die GfE lässt nichts auf Volkswagen kommen. Der GfE-Vorsitzende und Ratsherr Bernd Janssen arbeitet bei einem Bahnunternehmen, das VW-Autos transportiert. „Nicht nur die Stadt Emden lebt von VW“, sagt der Ostfriese Janssen, „ganz Ostfriesland lebt davon.“ Parteimitgründer Hinderikus Broer sagt: „VW ist Familie. Ich bin stolz auf VW. Wir bauen gute Autos.“ Den neuen Arteon finden sie in der Führung von „Gemeinsam für Emden“ alle klasse, Krise hin und Sparzwang her. „Tolles Auto.“
Das ist Niedersachsen: Nicht einmal Rebellen oder Populisten schimpfen hier auf Volkswagen.
Das Land und der Konzern. Wenn man sie so sieht als Paar, das im Laufe der Jahre diverse Krisen überstanden hat, dann kann man sich fragen, ob es nicht doch mal Zeit wäre für eine Trennung. Die Dieselaffäre ist doch im Grunde so etwas wie der ultimative Betrug gewesen, nach dem es keine Versöhnung mehr geben kann. Prompt gab es Zeitungskommentare, welche die Scheidung nahelegten. Auch Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP, forderte den Verkauf der Landesanteile.
Vor der Landtagswahl haben die Parteien wortreich gestritten über die richtigen Schlüsse aus der VW-Krise. Aber einig sind sich alle von links nach rechts, sogar die Landes-FDP: Das VW-Gesetz, das seit 1960 Land und Unternehmen aneinanderkettet, muss bleiben. Keiner will den 20-Prozent-Anteil an VW und das Vetorecht des Landes hergeben. Dabei geht es nicht nur um Geld. Es geht um die Identität eines Landes, das kein ganz unkompliziertes Verhältnis zu sich selbst hat.
Niedersachsen ist groß und vielfältig. Es weist die Küstenregion mit den ostfriesischen Inseln auf, das herrlich schroffe Mittelgebirge Harz, Großstädte und eine flache Weite, in der sich nur wenige Menschen verlieren. Zusammengesetzt wurde das Bundesland nach dem Zweiten Weltkrieg in der britischen Besatzungszone aus den Ländern Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg-Lippe – bis heute ergeben sich daraus regionale Animositäten, die manche lieber Feindschaften nennen. Mit einem einheitlichen Niedersachsen-Gefühl ist es daher so eine Sache – eigentlich gibt es das nicht. Nur mit dem VW-Logo können alle etwas anfangen.
Umso schlimmer, wenn es nicht nur für Qualitätsautos steht, sondern auch für Industriebetrug. „Die VW-Krise bedroht einen ganz wichtigen Kern des niedersächsischen Selbstverständnisses“, sagt Nils C. Bandelow, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Braunschweig. „Man hat hier kein richtiges Alleinstellungsmerkmal, das fängt schon damit an, dass wir keinen richtigen Dialekt haben“, sagt Bandelow. Lokale Freundeskreise klüngeln in provinzieller Selbstgefälligkeit vor sich hin. Hannover 96 und der VfL Wolfsburg gelten in der Bundesliga als eher gesichtslose Klubs. Die hübsche Universitätsstadt Oldenburg nennen Studenten „Oldenboring“, weil sie für junge Leute eine gähnende Langeweile ausstrahlt. Und über Hannovers Mittelmäßigkeit gibt es sogar ein Lied von Barbara Schöneberger, es heißt „Zu hässlich für München“.
Immerhin, in der Landwirtschaft ist Niedersachsen ganz vorn, weil so produktiv wie kein anderes Bundesland. Aber die Massentierhaltung in manchen Landkreisen gruselt nicht nur Tierschützer – als Identitätsstifter fällt die Schweinemast also aus. Und auch für Politikwissenschaftler Bandelow ist es kein Wunder, dass immer noch alle am VW-Gesetz festhalten. „Es wird als positive Ausnahme wahrgenommen“, sagt er und denkt an das einstige US-Zentrum der Autoindustrie, das sich längst im Niedergang befindet. „Es ist hier im Moment schon schöner als in Detroit.“
Überhaupt, die Jobs.
Christian Bleiel, 53, sitzt in seinem Büro in Salzgitter. Kein Papier auf dem Schreibtisch, der Teppich so grau wie Bleiels Anzug. Es gibt ein einziges Bild an der Wand, ein Großformat. Es zeigt: einen Motor. Bleiel ist der Chef des VW-Werks in Salzgitter, hier produziert der Konzern Otto- und Dieselmotoren. Auch die Motoren, die das ganze Theater ausgelöst haben, wurden hier produziert – allerdings, darauf legen sie hier Wert, nur die Hardware. Die Betrugssoftware wurde erst später aufgespielt auf ihre makellosen Supermotoren. Bleiel zeigt eine bunt gefärbte Darstellung des Werks. „Hier“, sagt er. „Da kommt es hin.“ Hier, das ist Halle 3, Erdgeschoss. Da soll die Zukunft gesichert werden, die Zukunft von Volkswagen, der deutschen Autoindustrie überhaupt. Und vor allem: die der Jobs.
„Wir müssen beweisen, dass wir es schaffen“, sagt der Werksleiter. Sonst sind die Jobs weg
In Halle 3, Erdgeschoß soll im kommenden Jahr die Elektro-Mobilität bei Volkswagen einziehen. 80 Millionen Euro investiert VW in eine Pilotanlage für die Batteriefertigung. Am Ende soll man wissen, ob das klappen kann: Batterien für E-Autos selbst herzustellen, wettbewerbsfähig und dennoch so günstig, dass man gegen die Konkurrenz aus Asien ankommt. „Wir müssen jetzt beweisen, dass wir das schaffen“, sagt Bleiel. Und dass man einen „Innovationssprung“ hinbekommen müsse. „Es reicht nicht, wenn wir nur das nachlegen, was Wettbewerber seit Jahren machen.“ Bleiel sagt das, als wäre es die leichteste Sache der Welt. „Wir haben beim Bau von Verbrennungsmotoren einen großen Vorsprung. Warum sollten wir das bei der Elektromobilität nicht auch hinbekommen?“
Man könnte antworten: Weil die deutsche Autoindustrie den Anschluss in Sachen E-Antrieb verpasst hat. Aber Bleiel macht deutlich, dass es keine Alternative gibt zum Erfolg. Er hat noch eine Grafik: Was bedeutet es, wenn sich die E-Mobilität mit eigener Batteriefertigung in Deutschland durchsetzt? Die Beschäftigungszahlen bei den Zulieferfirmen wären geringer als in Zeiten des Verbrennungsmotors. Aber in der Summe aller Jobs, die dann an der E-Mobilität hingen, wäre die Zahl der Arbeitsplätze sogar leicht höher als jetzt.
Und wenn es nicht gelingt?
Und wenn es nicht gelingt? Wenn man dann durch die Hallen fährt, drängt sich die Frage auf, warum das mit der E-Mobilität eigentlich so kompliziert sein soll. Um schneller durch die langen Fertigungsstraßen zu kommen, kann man mit einem „Cushman“ fahren. Der sieht aus wie ein Oldtimer für Kinder – und er hängt an der Steckdose. Der Cushman ist Baujahr 1969, er hat eine orangefarbene Warnlampe, die zeigt, wann er wieder an die Steckdose muss. In der Halle darf man 15 Kilometer je Stunde mit dem Cushman fahren. Läuft doch mit dem E-Antrieb.
7200 Leute arbeiten im VW-Motorenwerk in Salzgitter. Seit dem Beginn der Krise sind es weniger geworden, immer, wenn jemand in Rente geht, müssen die anderen die Arbeit neu verteilen. Effizienzsteigerung heißt das. Es wurde auch umgeschichtet: Weil nun mehr Otto- als Dieselmotoren verkauft werden, wurden Schichten verschoben und Teams verändert.
Manchen fällt die Veränderung schwerer als anderen, dabei ist es nur der Anfang. Wenn es klappt mit der Batteriezellenfertigung. Wenn nicht, dann erst recht. Werksleiter Christian Bleiel sagt: „Wenn wir es nicht schaffen, kostet das langfristig viele Tausend Arbeitsplätze.“ Nicht nur in Niedersachsen, nicht nur bei VW, sondern in ganz Europa. Dann kommt der Optimist in ihm wieder durch: „Ich traue unseren deutschen Ingenieuren da eine Menge zu.“